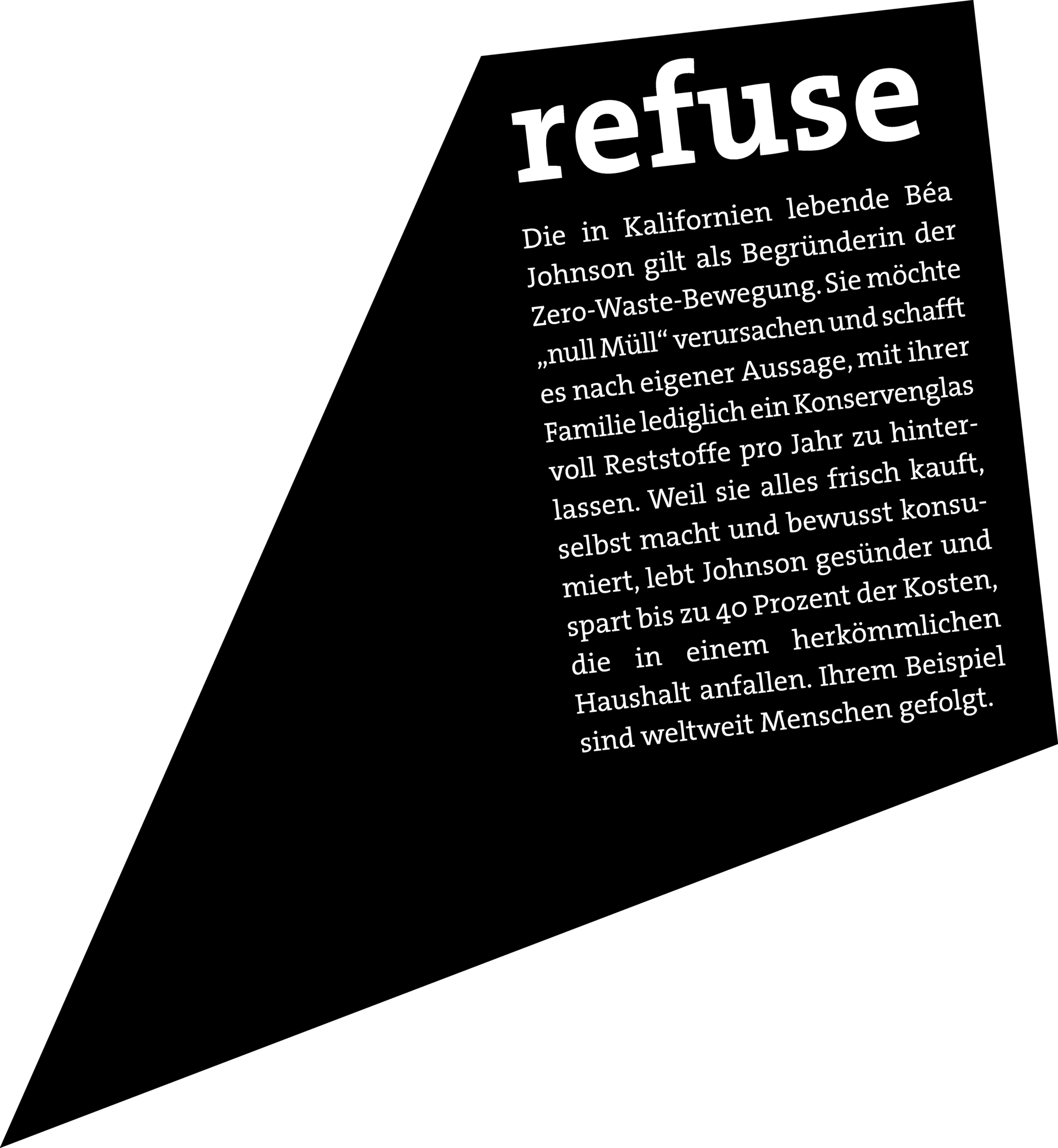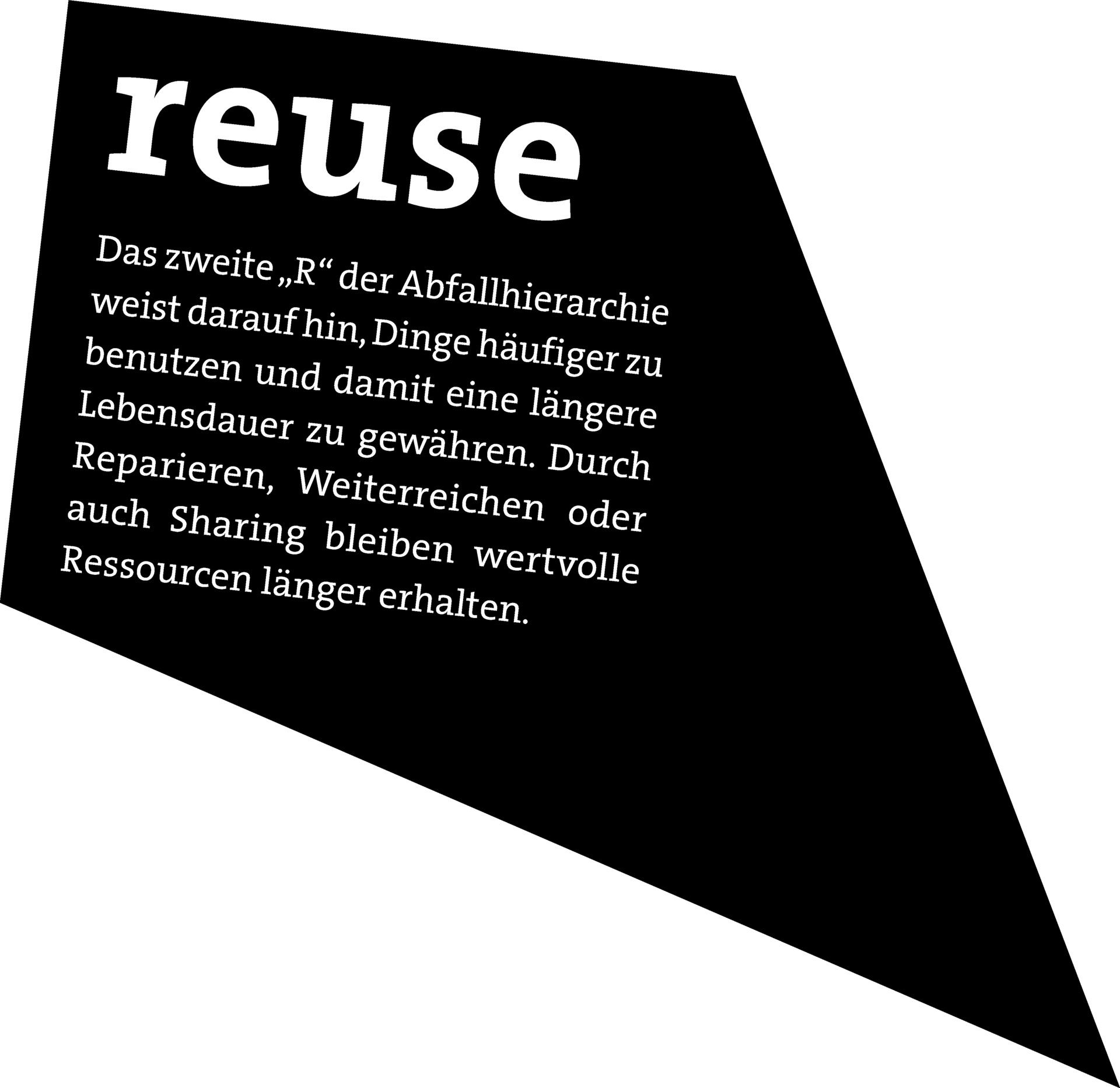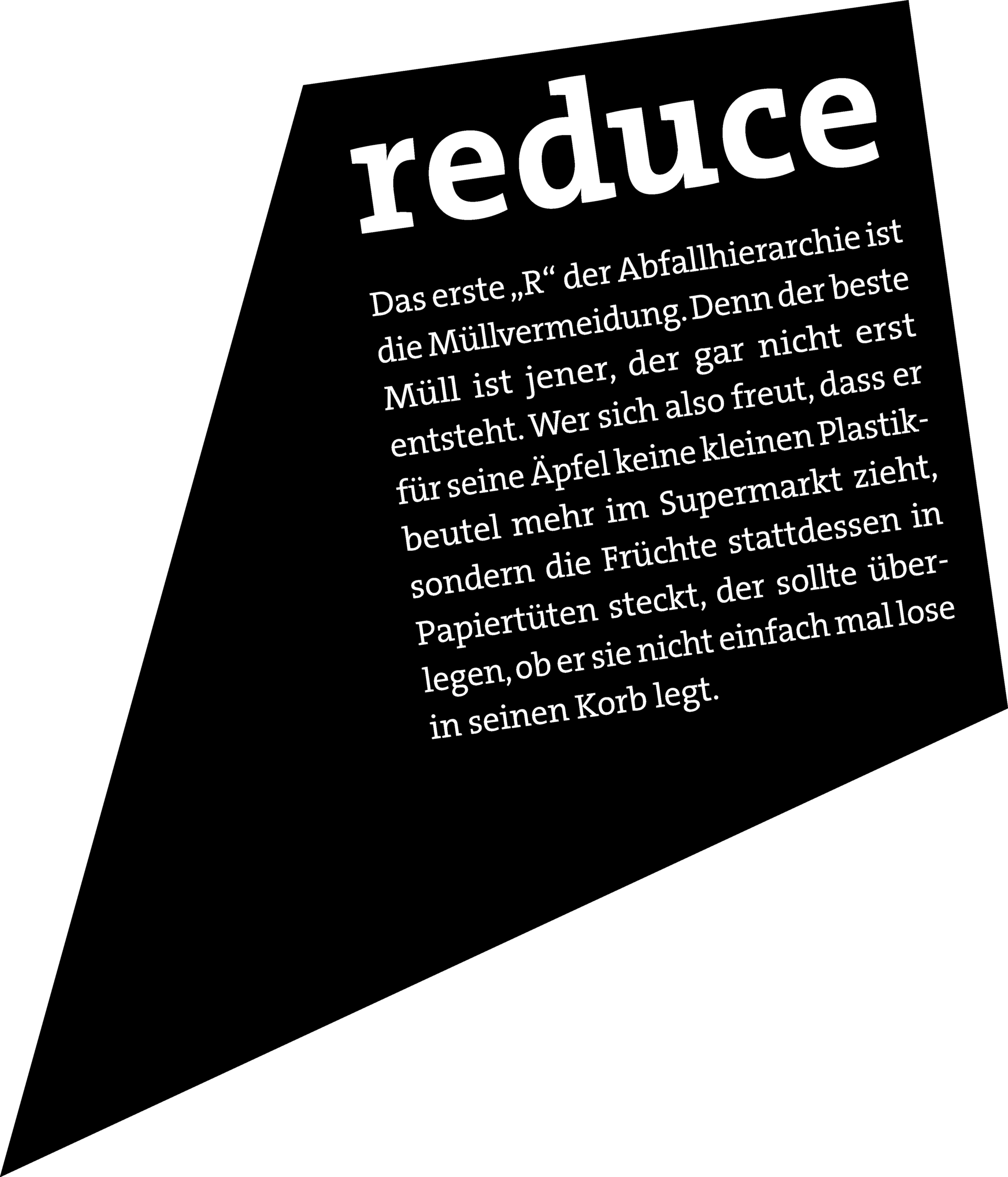
Heute landen Alaska-Seelachs und Bratkartoffeln in Verpackungen aus einem Material namens Bagasse. Das faserige Nebenprodukt der Zuckerrohrherstellung wird zu einem Brei verarbeitet und unter Hitze in Form gebracht. Die Verpackungen bei Nordsee sind damit zu 100 Prozent aus ohnehin anfallenden Resten hergestellt und biologisch abbaubar. Allerdings werden sie, realistisch betrachtet, wohl meistens im Straßenpapierkorb landen und da wird nichts kompostiert. Um Rohstoffe aus Europa zu verwenden, erforscht Nordsee außerdem mit dem Alfred- Wegener-Institut Verpackungen aus Makroalgen. Nicht alle mögen das: Manch einen Kunden stört der Geruch, sagt Hoffmann.
Die Experimente mit Verpackungen reihen sich ein in viele andere Maßnahmen, die Nordsee in den vergangenen Jahren durchgeführt hat: Roten Thunfisch oder Zackenbarsch findet man auf keiner Speisekarte, denn sie sind vom Aussterben bedroht. Lieferanten werden regelmäßig auf soziale und umweltrechtliche Nordsee-Standards überprüft. Zusätzlich fördert Nordsee den Verkauf von bio-zertifizierten Produkten und baut diesen Bereich laut eigenen Aussagen schrittweise weiter aus.
An dem Geschäftsmodell von Nordsee ändert das nichts: Der Systemgastronom verkauft Fisch im großen Stil, versorgt mehr als 19 Millionen Kunden mit einem Mehr vom Meer – nicht gerade das nachhaltigste Geschäftsmodell in Zeiten von Überfischung und Antibiotika-Zuchtskandalen. Zwar trägt der Konzern unter anderem das Nachhaltigkeitssiegel MSC. Der „blaue Fisch“ ist jedoch umstritten. So werden immer wieder Berichte publik, wonach auch mexikanische Thunfischflotten das Siegel tragen oder Grundschleppnetze vom MSC akzeptiert werden.
„Wir sind auf der Welt, um Essen zu verkaufen.“ Da ist Hoffmann ganz nüchtern. Man sei als Unternehmen in einer „Betreiberpflicht“: Ein Grundstock an Produkten muss in der Auslage liegen, damit die Kunden sich schnell etwas Leckeres aussuchen können. „Unsere Gäste haben nun mal nicht immer Zeit oder Verständnis dafür, dass auch mal ein Produkt alle sein könnte“, sagt Hoffmann. Teilweise werden die Fischwaren jedoch erst kurz vor Ladenschluss aufgefüllt oder Kunden bleiben plötzlich aus. „Da können wir noch so tolle Planungssysteme haben.“
Der Lebensmittelverschwendung begegnet der Konzern mit drei Maßnahmen: 97 Prozent der Filialen sind registrierte Anbieter bei „Too Good to Go“, einer App, mit der Nutzer übrig gebliebenes Essen billiger erwerben und so vor der Mülltonne bewahren können. Wer es lieber analog mag, kann aber auch in der Nordsee-Filiale 30 Minuten vor Ladenschluss und ganz ohne App alle Produkte um dreißig Prozent reduziert kaufen. Und wenn das Lachsfilet vor Ort einfach nicht mehr in den Magen passt, kann man sich jederzeit an einer Doggybag-Station eine Bagasse-Verpackung ziehen und das Essen einfach mitnehmen. „Sich als Unternehmen für die Umwelt zu engagieren, ist heutzutage keine Kür mehr“, erklärt Hoffmann. „Es ist Pflicht.“
Eine Pflicht, von der niemand etwas wissen soll? Das zumindest beobachtet das Branchenmagazin Horizont. So engagieren sich zwar immer mehr Konzerne für Nachhaltigkeit, kommunizieren dies in ihren Werbekampagnen aber wenig bis gar nicht. Ein Beispiel: der Lebensmittelhandel. Unternehmen wie Aldi, Rewe oder Edeka reduzieren ihren Plastikverbrauch seit Jahren sukzessive, in ihrer Kommunikation spielt das aber nur eine untergeordnete Rolle, so Horizont. Rewe zum Beispiel fahre große Kampagnen zu zuckerreduzierten Produkten, den schrittweisen Verzicht auf Plastik bewirbt der Handelskonzern verhältnismäßig weniger. Vielmehr begegneten die Initiativen der Händler den Kunden vornehmlich am so genannten „Point of Sale“ – an der Gemüsetheke beispielsweise.
Einen möglichen Grund dafür sieht Horizont aus Sicht der Unternehmen in der Gefahr, die Maßnahmen könnten als Greenwashing verstanden werden. Andere Konzerne fürchten, die Vermeidung von Plastik zu kommunizieren, weil sie so erst ein Bewusstsein bei den Verbrauchern schaffen, das weitere Begehrlichkeiten wecke, die die Unternehmen (noch) nicht bedienen können. Und wiederum andere Konzerne haben erst gar keine richtige Marketingabteilung, die ihre Mission verkünden könnte. Das ist zumindest beim Seifenhersteller Lush der Fall.
Kein drumherum
„Ich finde die Jellybombs ganz interessant, da ist ja auch Agar-Agar mit drin und das macht das Wasser ein bisschen gelee-artig.“ Dennis Oprisa steht vor einem Regal voll unzähliger, quietschbunter Badebomben. Es duftet nach Zitrone, Kokos, Rose und Kakaobutter, aus den Lautsprechern schallt laute Popmusik. Nach kurzem Zögern greift der Lush-Verkäufer nach „Secret Arts“, einer schwarzen Kugel, die mit „außen düster, innen lieblich“ beschriftet ist.
Er lässt sie in ein kleines Wasserbecken gleiten, die Kugel fängt an, sich sprudelnd aufzulösen, das Wasser wird dick, herb-würziger Duft steigt auf. „Merkst du schon was?“, fragt er. „Das ist halt wirklich Spaß vom Feinsten, ich meine: schwarzes Glitzerwasser! Das ist doch das, wovon man träumt, oder?“
Badebomben sind einer der Kassenschlager in der Lush-Filiale am Alexanderplatz. Faustgroße Kugeln in pink, gelb, schwarz, blau, als Schildkröte, Schiff oder Aubergine. Bei Lush gilt: Je schriller, desto besser. Dass hinter der knallbunten Fassade des Konzerns eine nachhaltige Mission steckt, bei der es unter anderem um das Verbannen von Plastik geht, wissen nur wenige.
Denn noch beliebter als die Badekugeln sind die Shampoo Bars. Vor mehr als zehn Jahren hat Lush das feste Haarshampoo auf den Markt gebracht. Ein Stück hält für 80 Haarwäschen – und ersetzt damit drei Plastikflaschen. Und weil im Badezimmer noch weit mehr Plastik beseitigt werden muss, gibt es bei Lush auch Deos, Lippenstifte, Gesichtscremes, Duschgels und alle anderen Körperpflegeprodukte „nackig“, wie man bei Lush sagt. Kaufen kann man die zum Beispiel in den drei Naked Shops in Manchester, Mailand und Berlin.
„Wir sind in den vergangenen 30 Jahren in der Diskussion um Recycling weit vorangekommen“, erklärt Ruth Andrade. „Plastik einsparen ist der nächste Schritt.“ Andrade ist so etwas wie die Umwelttante bei Lush. Offiziell heißt ihre Position „Organisational Development and Carbon Downdraw“. Sie selbst bezeichnet sich aber viel lieber als schwarze Optimistin mit einem Hang zum Aktionismus. „Ich bin unsere größte Kritikerin. Ich mag es, Lücken und Probleme zu finden und zu lösen.“